Im Gespräch: Autorin Susanne Fritz über ihr neues Buch „Heinrich“
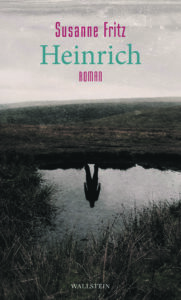 Die Themen für ihre Erzählungen, Essays und Romane entnimmt Susanne Fritz persönlicher Erfahrung und insbesondere den Biographien ihrer familiären Herkunft, die sie konsequent in geschichtliche Zusammenhänge einbettet. Mit ihrem Buch „Wie kommt der Krieg ins Kind“ untersuchte sie das Leben ihrer Mutter und widmet sich nun mit „Heinrich“ ihrem Vater. Trotz der Härte dieses Schicksals verzichtet die Autorin auf Larmoyanz, rechnet weder ab, noch verklärt sie, sondern unternimmt einen Rekonstruktionsversuch in fiktionaler Form, der die LeserInnen mitdenken lässt, indem er Spuren und Perspektiven bietet, keine einlinigen Inhalte. Unsere Mitarbeiterin Cornelia Frenkel hat Susanne Fritz zu ihrem literarischen Verfahren befragt.
Die Themen für ihre Erzählungen, Essays und Romane entnimmt Susanne Fritz persönlicher Erfahrung und insbesondere den Biographien ihrer familiären Herkunft, die sie konsequent in geschichtliche Zusammenhänge einbettet. Mit ihrem Buch „Wie kommt der Krieg ins Kind“ untersuchte sie das Leben ihrer Mutter und widmet sich nun mit „Heinrich“ ihrem Vater. Trotz der Härte dieses Schicksals verzichtet die Autorin auf Larmoyanz, rechnet weder ab, noch verklärt sie, sondern unternimmt einen Rekonstruktionsversuch in fiktionaler Form, der die LeserInnen mitdenken lässt, indem er Spuren und Perspektiven bietet, keine einlinigen Inhalte. Unsere Mitarbeiterin Cornelia Frenkel hat Susanne Fritz zu ihrem literarischen Verfahren befragt.
Kultur Joker: Für den ehemaligen Wehrmachtssoldaten „Heinrich“ beginnt erst nach der Kriegsgefangenschaft, mit 23 Jahren, ein „eigenes“ Leben. Seine Tochter, die Ich-Erzählerin, will die Jahre davor erhellen, darunter seine Haltung in der NS-Zeit und im Zweiten Weltkrieg. Stets schwingt die Frage mit: Wie lässt sich so eine Geschichte überhaupt erzählen?
Susanne Fritz: Indem wir beginnen, Fragen zu stellen: Wie kommt es, dass ich so wenig über meinen eigenen Vater weiß? Warum hat er so wenig erzählt? Aber auch: Warum haben wir so wenig gefragt und wirklich wissen wollen? Dabei stoße ich auf ein starkes Motiv der Kriegsgeneration: auf die Scham – die neben Schuldgefühlen die Menschen in sich einsperren. Auf eine innere Not, die das Erzählen schwer macht, unmöglich. Auf die Angst vor Ablehnung, Verurteilung, Unverständnis. So umkreise ich Leerstellen, entdecke immer mehr Spuren, wie im Schnee oder im Sand. Ich beginne zu notieren, Einzelheiten, Bruchstücke, einzelne Szenen. Nach und nach entstehen Bilder, lassen sich mögliche Zusammenhänge erkennen.
Kultur Joker: „Heinrichs“ Biographie ist exemplarisch für eine Generation, die sich meist erst spät ihre Traumata vergegenwärtigen konnte. Dem Jugendlichen, aufgewachsen als Angehöriger einer deutschen Minderheit in einem polnischen Armutsviertel, eröffnen sich Aufstiegschancen, als die Nazis im Herbst 1939 einmarschieren. 1949, nach Krieg und Gefangenschaft, gelangt er nach Westdeutschland, macht Karriere und gründet Familie. Seine dramatische Laufbahn verfolgt ihn?
Susanne Fritz: Der Begriff Trauma ist ja erst in den letzten Jahren „populär“ geworden. Die Kriegsgeneration unserer Eltern und Großeltern versuchte, mit ihren Wunden und Schuldgefühlen irgendwie zu leben – ohne psychologischen Wortschatz und therapeutisches Angebot. Die Beschädigung hat ja so viele betroffen, also versuchten sie, diese nicht persönlich zu nehmen, begegneten sich selbst und anderen mit einer gewissen Härte, Gefühlskälte, Erbarmungslosigkeit. In der Nachkriegszeit schaute man mit aller Macht nach vorne. Wie Heinrich, der eine enorme Energie entwickelte, um voranzukommen, es zu etwas zu bringen. Er versuchte nichts weniger, als sich selbst zu erschaffen. Er wird zu seinem eigenen Traum. Eine Art neuer Mensch. Wie passt da das Trauma dazu? Vielleicht als eine „negative Folie“: Das neue Leben sollte dem vorangegangen in nichts gleichen. Ehrgeizig und sehr talentiert arbeitet er sich empor. An seinen Erfolgen aber hält er nicht fest. Erstaunlich! Ich kann nur mutmaßen, warum: Er hat die Welt brennen sehen, hat selbst mehrmals nur durch Zufall und großes Glück überlebt. Heinrich kann es im Grunde kaum glauben, noch auf der Welt zu sein, er bleibt ein Zweifler, misstraut aller Sicherheit, allem Wohlstand.
Kultur Joker: Sie stützen sich auf spärliche Familiendokumente sowie Aufzeichnungen von „Heinrich“ und haben historische Recherchen unternommen, ihr Text verbindet Fakten und Vermutungen, aber man hat nie den Eindruck, dass es sich um eine Fiktion handelt. Betonen Sie dennoch Literarizität, indem „Heinrich“ als „Roman“ bezeichnet wird?
Susanne Fritz: Anders als in „Wie kommt der Krieg ins Kind“ spielt Faktisches in „Heinrich“ keine tragende Rolle. Das Buch ist auch nicht aus der „Tochterperspektive“ geschrieben, sondern aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln. Sogar ein Apfel erzählt von „Heinrich“! Es ging mir nicht um eine finale Wahrheitsfindung oder die einigermaßen zuverlässige Rekonstruktion einer Wirklichkeit, sondern um den Erinnerungsprozess selbst. Das Gedächtnis ist, wie wir wissen, äußerst unzuverlässig. Es reagiert auf alle möglichen Einflüsse und Einflüsterungen, ist also manipulierbar. Die Drehpunkte der Wahrheit faszinieren mich. „Da kann man wieder einmal sehen, wie leicht Geschichte verfälscht wird. Besonders dann, wenn die Spuren blass sind, wir wenige Beweismittel in der Hand und ein bestimmtes Interesse haben. Ein Name, und schon entsteht ein Bild“, heißt es an einer Stelle. Wir lassen uns von Erzählungen hinreißen und verführen – in „Heinrich“ wird die Geschichte spielerisch und frei erzählt, darum Roman.
Kultur Joker: Mit ihrem Buch arbeiten Sie NS- und Nachkriegsgeschichte auf und blicken episodisch auf die eigene Kindheit und ihre Prägungen zurück. Es treibt Sie nicht zuletzt die Frage nach den Kontinuitäten faschistischer Gewalterfahrung um?
Susanne Fritz: Diese Kontinuitäten sind leider Fakt, wir müssen uns mit ihnen beschäftigen. Aktuell erleben wir mitten in Europa einen Rechtsruck. Wohin steuert unsere Gesellschaft? Antidemokratische Strömungen haben Zulauf. Warum? Was versprechen sich die Menschen von autoritären Systemen? Ein Motiv könnte das Gefühl der eigenen Machtlosigkeit sein. Anbetracht großer, komplexer Krisen wünschen wir uns jemanden, der einfache Lösungen parat hat, der „durchgreift“ und uns „erlöst“, auch auf Kosten von Empathie und Mitmenschlichkeit. Die Generation, die Diktatur und Krieg erlebt hat, verabschiedet sich. Auch meine Eltern sind verstorben. Sie haben aus ihrer Verführbarkeit als Jugendliche, ihrer einstigen Faszination für den NS keinen Hehl gemacht. Zugleich waren sie reflektierte, wache Zeitgenossen, haben das politische Geschehen mit großem Interesse verfolgt. Kein Tag verging ohne politische Diskussionen am Tisch. Für ihre Ehrlichkeit bin ich ihnen bis heute dankbar. Über die gegenwärtigen Entwicklungen, den neuerlichen Krieg, wären sie verzweifelt.
Kultur Joker: Ihr Text beginnt mit einem Unfall, bei dem ein Spiegel zu Bruch geht. Stetig begleitet „Heinrich“ das „Unbehagen Spiegeln gegenüber“. Warum dieses Bild?
Susanne Fritz: Exemplarisch für die Kriegsgeneration sind die starken Brüche. Die Trümmer. Splitter. Heinrich ist 1926 geboren und lebte unter sehr unterschiedlichen Bedingungen, erlebte Armut und Wohlstand, Diktatur und Demokratie, Krieg und Frieden. Die erste Aufstiegschance, Sie haben es vorhin erwähnt, bietet ihm ausgerechnet ein verbrecherisches System, das den Jugendlichen korrumpiert und in den Krieg hineinzieht. Also Soldat wird er zum Pazifisten, die Schlacht aber geht vorläufig weiter. Im Laufe seines Lebens macht er erstaunliche „Häutungen“ durch. Wie hängen die verschiedenen Facetten Heinrichs zusammen? Wie kann ich die einzelnen Splitter oder Puzzleteile sinnvoll zusammenlegen? Und: Zuletzt bleibt jedes Leben rätselhaft, „unlösbar“, vieldeutig.
Kultur Joker: Könnte es für die „Nachgeborenen“ – im Sinne Bertold Brechts – wichtig bleiben, nicht ungerecht zu werden?
Susanne Fritz: Ein starkes Gedicht, das Zeile für Zeile unter die Haut geht und die verrückte Bandbreite menschlicher Existenz auffächert. „Zufällig bin ich verschont…“, heißt es da. Diesen „Zufall“ oder anders gesagt die Privilegien, denen wir einen Großteil unseres Glücks und Wohlstands verdanken, können wir uns vielleicht gar nicht genug klarmachen. Nun sind wir nicht nur „Nachgeborene“. Wir haben selbst dafür Sorge zu tragen, dass über „Bäume zu sprechen“ nicht bedeutet, dabei Ungerechtigkeit und Verbrechen zu verdrängen. Die „finsteren Zeiten“, von denen Brecht spricht, sind leider keine Frage der Vergangenheit, über die wir uns selbstgerecht erheben könnten. Jeden Tag können wir etwas dafür tun, dass sich „die Zeiten“, in denen wir leben, nicht vor unseren Augen verdunkeln.
Kultur Joker: Ich bedanke mich für Ihre Ausführungen.
Bildquellen
- „Heinrich“: Cover: Wallstein Verlag
- Susanne Fritz: © Julius Erler


