Alles ist anders, als es einmal war. So wird auch die diesjährige Preisverleihung nicht wie seit jeher am 3. April, dem Geburtstag des Lyrikers Peter Huchel (1903-1981), stattfinden, sondern voraussichtlich am 21. Mai in Staufen öffentlich nachgeholt werden. Zusammen mit Marcel Beyer soll bei dieser Gelegenheit auch der letztjährige Preisträger Henning Ziebritzki nachträglich noch für seinen Gedichtsband „Vogelwerk“ geehrt werden. Die Veranstaltung war 2020, wie so vieles, durch Corona verhindert worden.
Der Peter-Huchel-Preis für deutschsprachige Lyrik wird jeweils für einen im voran gegangenen Jahr erschienen Gedichtband vergeben, den eine Jury als herausragend erachtet. Während es mit dem Tübinger Henning Ziebritzki zuvor einen kaum bekannten Autor traf, ist es diesmal der schon vielfach ausgezeichnete Marcel Beyer, der 1965 in Tailfingen geboren wurde und lange schon in Dresden lebt. „Dämonenräumdienst“ ist ein weiteres Kabinettstück seiner Lyrik, im Jahr des Erscheinens 2020 von der Kritik allseits hoch gelobt. Ein Höhepunkt seiner Karriere war schon der Georg-Büchner-Preis, der ihm 2016 für ein Werk verliehen wurde, welches Romane, Gedichte und Essays enthält und in nunmehr über drei Jahrzehnten entstanden ist. Ein ungewöhnliches, äußerst eigenwilliges Werk ist es, in dem die Welt auf wundersame Weise bekannt erscheint und durch eine kunstvolle, irisierende Sprache surreal verwandelt wird und neu betrachtet werden will. Von Anfang an setzte sich der Schriftsteller und Dichter mit der deutschen Geschichte, insbesondere mit der NS-Zeit auseinander, mit der Erinnerung an die eigene Kindheit, an Mythen und Märchen, die Stationen seiner Sozialisation. Es ist immer ein poetisches Nachspüren, durch das auch der Irrsinn und Irrwitz unserer Epoche zum Vorschein kommt.
Mit seinem „Dämonenräumdienst“ bewegt sich Marcel Beyer einmal mehr durch ein anscheinend vertrautes, doch letztlich vermintes Gelände. Man gerät unversehens in ein Zwielicht, wo Untote und Wiedergänger herumirren, Gespenster der Geschichte, Gestalten der Popkultur und manch traurig-komischer Held („Der Mann mit dem schiefen Maul“). Es entstehen unheimliche Szenerien, hervorgerufen durch das, was dem Dichter so alles durch den Kopf geht und geistert, womit er spielt und frei assoziiert – was eben die Suchmaschine in seinem Kopf so alles hergibt („Mir glüht der Schädel in allen Fasern…“). Doch mit diesen Turbulenzen geht Marcel Beyer sicher um wie ein Zeremonienmeister, der auf seine sprachliche Virtuosität bauen kann. Was ebenfalls ein Überborden verhindert, ist eine gleichmäßig festgelegte Form, in der die Poesie wild wuchern kann. Alle Gedichte sind vierzig Verszeilen lang und in jeweils zehn vierzeilige Strophen unterteilt. Das schafft beim Durchblättern des umfangreichen Buches einen einheitlichen optisch-graphischen Eindruck, ein Bild, das aber Ordentlichkeit nur vortäuscht. Denn: „Geister sind das hier in deiner / Bude, deren letzten Winkel / die Tchibo-Taschenlampe nicht erfasst…“
Manchmal fühlt man sich etwas hinters Licht geführt. Ein Schabernack um uns zu überlisten, die Dinge mit andern Augen sehen zu sollen? Doch viele der Gedichte bleiben durch ihre Schrägheit, die sprachlichen Verschränkungen zunächst ziemlich unzugänglich. Den wilden, grotesken Vorgängen ist oftmals erst durch wiederholtes Lesen beizukommen. Die Wirklichkeit wird hier nicht abgebildet, sondern lustvoll und spielerisch durcheinander gewirbelt zu einer womöglich größeren Kenntlichkeit oder Erkenntnis. Stringenz muss hier nicht unbedingt ein Kriterium, und Poesie sowieso nicht vernünftig oder politisch korrekt sein, und das ist gut so. Mit seinen kunstvollen, kühnen Spracheskapaden, dem Jonglieren mit sprachlichen Versatzstücken und Verweisen auf Alltagsgegenstände („Ratansofa“) erschafft Marcel Beyer eine ganz eigene Welt, die bei aller Verquertheit oder vielleicht gerade dadurch, viel mit der unseren zu tun hat. Sein „Dämonenräumdienst“ erweist sich als ein Geschäft ohne Ende, denn da geht es um die Entsorgung von allerlei Sprach- und Zivilisationsmüll. So heißt es in dem Gedicht „Kosmos“: „…ein Jahrzehnt nach dem andern will / uns mit seinem Abfall unter / sich begraben, Großeltern, Eltern / und Kind. Im Kopf der ganze / Weltraumschrott aus fernen vierzig / Jahren. Und keiner räumt / etwas weg. Was bleibt uns für eine / Wahl, wir müssen ins All …“
Doch bleiben wir auf dem Boden, lassen wir uns ein aufs irdische Treiben. Dort begegnen wir dem Modedesigner Rudolph Moshammer mit den bekannten Stirnlocken, wie er seinen Yorkshire Terrier Daisy durch einen Münchner Abend trägt, bis zu seinem bitteren Ende. Oder Hildegard Knef, die nach allerlei Verrichtungen endlich im Regenmantel und mit Sonnenbrille das Haus verlässt und ins Auto steigt, um nach Berchtesgaden zu ihrer Wunderheilerin zu düsen. Und noch viele andere Figuren aus Vergangenheit und Gegenwart, Populär- und Hochkultur geben sich wie in einem Panoptikum ein Stelldichein. Manchmal tritt auch ein „lyrisches Ich“ deutlich hervor, doch gleich versteckt es sich wieder hinter Masken und spricht, auf Dämonenart, mit vielen Zungen. Selbst Vertreter aus der Tierwelt melden sich zu Wort, ein Hund, ein Affe, sogar eine Gemeine Küchenschabe. „Der Dichter arbeitet als Reh / im Innendienst…“, wird in dem Gedicht „Bambi“ vermeldet. Die Titel der Gedichte bezeichnen zumeist nur die Namen der Dinge, Themen, Tiere und Pflanzen, um die es, mehr oder weniger, geht. Immer zuverlässig sind es außergewöhnliche Betrachtungen, die in unerhörte Zusammenhänge gebracht werden. Selbstironisch hofft der Dichter: „… ich schreibe diese Gedichte / wie ein Kind, das heimlich / tut und einfach froh ist, wenn / niemand mit ihm schimpft.
Unter den Texten, die dann doch durch ihre Geschlossenheit und Eindrücklichkeit hervorzuheben sind, findet sich neben dem „Moshammer“- und dem Knef-Gedicht („Benzin“) eines mit dem Titel „Schwermut“, das einen Sommer im Leben des Heranwachsenden beschreibt: „Ich lernte, es ist nie zu spät für einen / Neuanfang in Flandern. Ein Bild aus / der Zuchtstation, das man nicht vergisst: / Der Blick des Fohlens Frantic, hinter / Glas. Ich las in jenem Sommer / Pferdekrimis, einen nach dem andern.“ Auch „Depot“ ist ein weiteres unter jenen Gedichten, die sich besonders einprägen. Da werden wir mit hinunter genommen in die Abstellkammer eines imaginären Museums, wo Werke lagern, „die kein Lebender / je zu Gesicht bekommen hat, für immer / ins Dunkel geschobene Tafelbilder, ohne / Blick verräumte Skizzen und Studien…“ Darunter „Schongauers erfrorene Hände, Goyas ausgeschütteter Wein… „ Und nicht zu vergessen: „Dieser fein gezeichnete / Tausendfüßler, vom siebenjährigen Goethe / mit dem Fingernagel in ein Stück Schiefer / gekratzt: Nur die Sprache noch kann sich / an ihn klammern…“
Der Gedichtband ist in fünf Kapitel unterteilt, besonders im letzten ist Marcel Beyer ganz in seinem Element. Es ist ein Zyklus unter dem Titel „Die Bunkerkönigin“, in dem stufenweise abgetaucht wird in die Untiefen deutscher Kriegs- und Nachkriegsgeschichte. „Bei Nacht bin ich in den leeren / Bunker gestiegen. Ich räume / auf vor dem inneren Auge / und lasse die Moorbrühe / aus dem Betonboten sprudeln, / vergrabe die Finger im / Moos, das die Wände rundum / überzieht. Ich phantasiere…“ Es ist ein gewissermaßen archäologisches Graben, durch das Zeitgeschichte, bei aller Glitschigkeit, dinglich und habhaft gemacht wird. Was Marcel Beyer in diesen Phantasmagorien zur Sprache bringt, gehört zum Stärksten dieses insgesamt außergewöhnlichen, auf seine Art unerschöpflichen Werks. Am Ende stellt sich zum „Dämonenräumdienst“, nimmt man den Titel wortwörtlich, nur noch die Frage: Treibt hier einer seine Dämonen aus, oder beschwört er sie erst herauf? Ganz wie Goethes „Zauberlehrling“, der die Geister rief und sie nicht mehr los wurde?
Marcel Beyer: Dämonenräumdienst. Gedichte. Suhrkamp Verlag, Berlin 2020. 173 Seiten, 23 Euro.

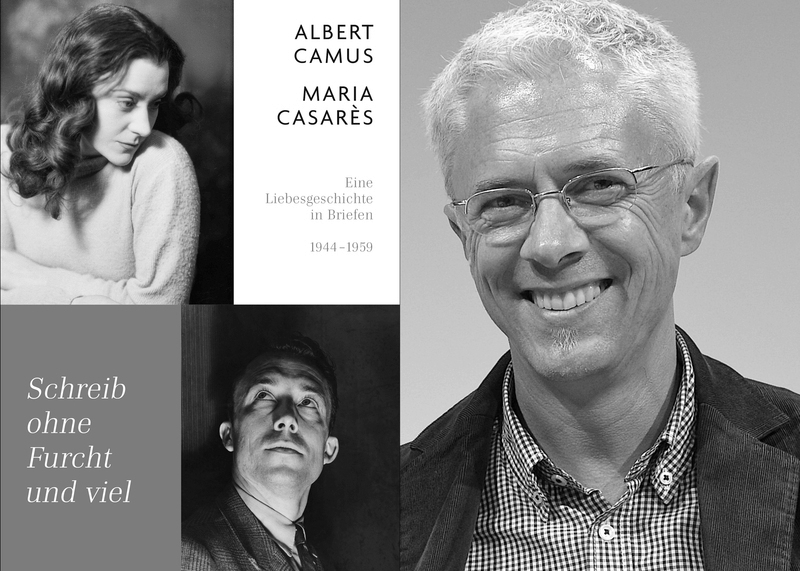

 Hure“, als die sie von den Kirchenvätern dargestellt wurde und war Judas der „gemeine Verräter“, der seinen Meister gegen Silberlinge ausgeliefert hat? Diesen Fragen spürt Franz Alt nach, verneint sie kategorisch und setzt dagegen: Der besondere Mensch Jesus habe in Abgrenzung zum zu seinen Lebzeiten herrschenden Tempelkult in Jerusalem ein neues Gottes- und Menschenbild entwickelt. Gott ist für ihn sein „Abba“, das meint aramäisch mütterlicher oder gütiger Vater. Dessen Lehre verkündete er nach seiner Taufe durch Johannes in seiner Muttersprache aramäisch als „Heiler“, indem er durch Galiläa zog und sich mit den “Schwachen, den Hungernden, den Kranken, den Gefangenen, den Kindern und den Frauen“ solidarisierte. Eine Lehre von der friedvollen Liebe aller Menschen zueinander. In diesem Geiste scharte er Anhänger um sich, darunter auch Maria Magdalena und Judas. Beide wurden, so Alt, die engsten und geliebten Vertrauten und Ratgeber von Jesus. Im Falle von Maria Magdalena war dies, gemessen am damals herrschenden Frauenbild, ein eklatanter Tabubruch. Judas habe, entgegen der biblischen Behauptung, Jesus nicht verraten, sondern ihn in Jesu Auftrag und auf dessen Geheiß der Obrigkeit übergeben. Jesus wollte selbst – im Einklang mit seinem „Abba“ – ans Kreuz, um für seine Botschaft bis zum Äußersten zu gehen.
Hure“, als die sie von den Kirchenvätern dargestellt wurde und war Judas der „gemeine Verräter“, der seinen Meister gegen Silberlinge ausgeliefert hat? Diesen Fragen spürt Franz Alt nach, verneint sie kategorisch und setzt dagegen: Der besondere Mensch Jesus habe in Abgrenzung zum zu seinen Lebzeiten herrschenden Tempelkult in Jerusalem ein neues Gottes- und Menschenbild entwickelt. Gott ist für ihn sein „Abba“, das meint aramäisch mütterlicher oder gütiger Vater. Dessen Lehre verkündete er nach seiner Taufe durch Johannes in seiner Muttersprache aramäisch als „Heiler“, indem er durch Galiläa zog und sich mit den “Schwachen, den Hungernden, den Kranken, den Gefangenen, den Kindern und den Frauen“ solidarisierte. Eine Lehre von der friedvollen Liebe aller Menschen zueinander. In diesem Geiste scharte er Anhänger um sich, darunter auch Maria Magdalena und Judas. Beide wurden, so Alt, die engsten und geliebten Vertrauten und Ratgeber von Jesus. Im Falle von Maria Magdalena war dies, gemessen am damals herrschenden Frauenbild, ein eklatanter Tabubruch. Judas habe, entgegen der biblischen Behauptung, Jesus nicht verraten, sondern ihn in Jesu Auftrag und auf dessen Geheiß der Obrigkeit übergeben. Jesus wollte selbst – im Einklang mit seinem „Abba“ – ans Kreuz, um für seine Botschaft bis zum Äußersten zu gehen.

